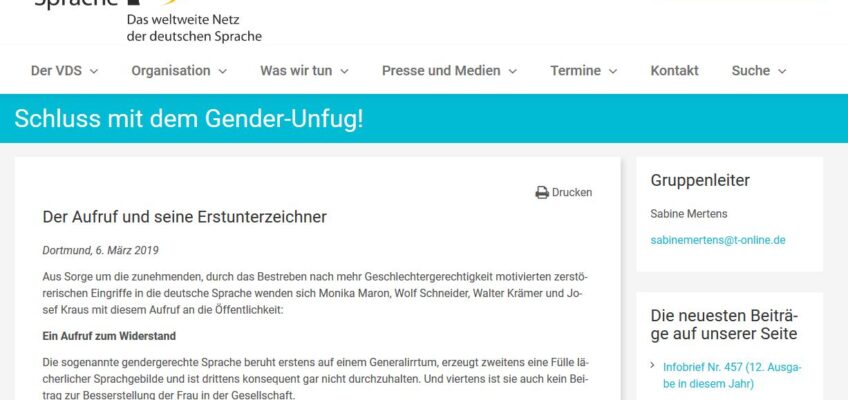Vor langer Zeit erschien mal ein Aufruf, der sich wie Donnerhall verbreitete. Lauschen wir hier einigen Zeilen nach:
„Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am 5ten Tage, und die Fürsten und Vornehmen am 6ten gemacht, und als hätte der Herr zu diesen gesagt: Herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigne Sprache; das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug und treibt ihn mit den Ochsen am Pflug, er nimmt das Korn und läßt ihm die Stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag; Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen, sein Leib ist eine Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen […]“
Ein Meisterwerk politischer Prosa, den der junge Dichter Georg Büchner da zu Papier brachte: die Verben tragen die Aussagen, Sprachbilder erzeugen ein lebhaftes Kopfkino, die Satzstrukturen sind übersichtlich und klar. Und dann vor allem dieses revolutionäre Pathos! Da brennt einer für eine Sache und reißt den Leser mit in seinen Taumel – und das allein durch seine Sprache! Erschütternd dieser Aufruf, auch heute noch.
Wie glücklich können wir uns Heutige deshalb schätzen, dass auch wir wieder Zeitzeugen eines epochalen Aufrufs werden durften – des Aufrufs „Schluss mit dem Gender Unfug“. Und da er vom Verein Deutsche Sprache stammt, kann man sich geradezu auf ein Feuerwerk sprachlicher Finessen freuen. An diesen Worten wollen wir uns laben wie ein Verdurstender an den kühlen Quellen einer Wüstenoase:
„Aus Sorge um die zunehmenden, durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motivierten zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache wenden sich Monika Maron, Wolf Schneider, Walter Krämer und Josef Kraus mit diesem Aufruf an die Öffentlichkeit: Ein Aufruf zum Widerstand
Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf einem Generalirrtum, erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens konsequent gar nicht durchzuhalten. Und viertens ist sie auch kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft […]“
Oh mein Gott!, möchte man ausrufen und sich mit Grausen wenden. Krachender Nominalstil, kein Sprachbild nirgends und mittenmang ein unglaublich aufgeblasener moralischer Anspruch: Widerstand. Saudi-arabische Frauenrechtsaktivistinnen würden wahrscheinlich piepen vor Lachen … wenn Sie nur die Chance hätten, Kunde vom heroischen Opfergang dieser gesellschaftlich bestens etablierten Sprachnörgler zu erhalten. Kurz: Echter Textmüll – und das von den selbsternannten Rettern der deutschen Sprache. Erschütternd das. Wirklich erschütternd.
Aber wir wollen keine Sprachkritik üben. Schließlich geht es um Inhalte. Da heißt es zum Beispiel:
„Der Generalirrtum: Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht bestehe ein fester Zusammenhang. Er besteht absolut nicht. Der Löwe, die Giraffe, das Pferd.“
Jesses: Wollen die Autorinnen (Männer sind natürlich immer mitgemeint) uns wirklich weismachen, dass uns diese sprachliche Freiheit auch dann zu Gebote steht, wenn Personen in den Herrschaftsbereich der deutschen Sprache rücken. Sollen wir wirklich glauben, dass wir auch „das Bäcker“ sagen dürfen oder „der Kindergärtnerin“ oder „die Soldat“? Doch wohl nicht. Denn offensichtlich herrscht bei der Beschreibung menschlicher Akteure durchaus ein enger Zusammenhang zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht. Und zwar sowas von.
Weiter heißt es:
„Die lächerlichen Sprachgebilde: Die Radfahrenden, die Fahrzeugführenden sind schon in die Straßenverkehrsordnung vorgedrungen, die Studierenden haben die Universitäten erobert, die Arbeitnehmenden viele Betriebe.“
Lächerliche Sprachgebilde? Die altehrwürdigen Partizipien der Deutschen als lächerliche Sprachgebilde? Haben wir etwa schon vergessen, dass der federkielschwingende Übersetzer Johann Heinrich Voß mit Vorliebe sich gerade dieser gefühlebewegenden Komponenten mit wachsender Begeisterung bediente? Denn die nervenzerfetzenden Abenteuer seiner Übersetzung der Illias strotzen nur so vor bilderhervorrufenden Mittelwörtern. Wenn der Spracherneuernde aus Mecklenburg diese auch eher als sich hinzugesellende Adjektive verwendet, so setzt er sie zuweilen auch als Hauptwörter ein, die Gegenstanderzeugenden. So „erschollen die Pfeile zugleich an des Zürnenden Schulter“, erscheinen die edlen Söhne Achaias als „die Richtenden“, an anderer Stelle preisen sie „des Treffenden Macht“. Diese vermeintlich lächerlichen Sprachgebilde – durch den Dichter und Übersetzer Johann Heinrich Voß haben sie höhere sprachliche Weihen erhalten und diesem selbst einen Logenplatz in der Literaturgeschichte gesichert.
Der Gott der Grammatik
Gegen Ende des Aufrufs nimmt der Text die Tonlage eher schlechter Comedy an:
„Nicht durchzuhalten: Wie kommt der Bürgermeister dazu, sich bei den Wählerinnen und Wählern zu bedanken – ohne einzusehen, dass er sich natürlich „Bürgerinnen- und Bürgermeister“ nennen müsste? Wie lange können wir noch auf ein Einwohnerinnen- und Einwohnermeldeamt verzichten? Wie ertragen wir es, in der Fernsehwerbung täglich dutzendfach zu hören, wir sollten uns über Risiken und Nebenwirkungen bei unserm Arzt oder Apotheker informieren? Warum fehlt im Duden das Stichwort „Christinnentum“ – da er doch die Christin vom Christen unterscheidet?“
Wie kommt der mit toternstem moralischen Anspruch („Widerstand“) auftretende Aufruf dazu, in derartige Albernheiten zu entgleiten, die mit der Realität nicht mehr das Geringste zu tun haben? Wie lange ertragen wir es, dass dieser Text auf das Witzniveau des Mitunterzeichners Didi Hallervorden absinkt? Und überhaupt: Warum verzichten die Autorinnen (Männer sind immer mitgemeint) unbegreiflicherweise darauf, ihre stärksten Argumente ins Feld zu führen? Vielleicht einfach deshalb, weil sie ihnen – palim palim – nicht trauen?
Holen wir es deshalb an dieser Stelle einmal nach. Zurück also zum Gebrauch des Partizips als Nomen. In der Tat ist zu bedenken, dass mit der Überführung des „Studenten“ zum „Studierenden“ ein Bedeutungswechsel stattfindet. Beim ersten Begriff handelt es um den Status, der auch dann gilt, wenn dieser Mensch gerade nicht über den Büchern sitzt. Das Partizip „Studierender“ hingegen nimmt eine aktuelle Tätigkeit in den Blick. Es signalisiert: Der so Bezeichnete befindet sich zurzeit im Prozess des Studierens – vulgo: er recherchiert zu einem Thema, liest, exzerpiert, denkt, wägt ab – oder schreibt einfach stumpf nach der zunehmend beliebter werdenden Zu-Gutenberg-Methode® ab.
Und dennoch: Ist dieses Prinzip auch die Regel in der deutschen Sprache, so gilt sie dennoch nicht absolut. Ein Vorsitzender ist auch dann ein Vorsitzender, wenn er nachts im Bett liegt. Ein Glaubender bleibt es auch dann, wenn er in seinem Beruf als Naturwissenschaftler ansonsten nur das für wahr hält, was er reproduzierbar beweisen kann. Ein Auszubildender bleibt es auch dann, wenn er in der Disko vor allem seine Anbagger-Techniken ausbildet. Und ein Handlungsreisender bleibt auch dann ein Handlungsreisender, wenn er tot ist und wir sein Leben und Sterben aus der Retrospektive betrachten. Die deutsche Sprache bietet also durchaus aus sich selbst heraus eine Anschlussfähigkeit für den gehäuften Gebrauch des Partizips als Nomen.
Wenden wir uns deshalb dem zweiten starken Argument zu, dem des generischen Maskulinums. Ein schwieriges Wort mit einfachem Inhalt. Es besagt, dass männliche Pluralformen weibliche Mitglieder in gemischtgeschlechtlichen Gruppen immer mitmeinen. Deshalb ist es für die Mitunterzeichnende Monika Maron auch kein Problem, dass sie einerseits im Rahmen des Aufrufs als Teil einer Gruppe von Schriftstellern (männliche Pluralform) auftritt, während sie andererseits Wert darauf legt, als Schriftstellerin (weibliche Singularform) zu unterschreiben. So weit die Theorie … die wir allerdings nicht unbedingt für wahr halten müssen, wie der folgende kleine Fakten-Check beweist. Lesen Sie mal kurz folgende Sätze:
- Am Dienstag lade ich Sie wieder zur Sitzung der Abteilungsleiter ein.
- Neue Hygienevorschriften für Erzieher in der Kita.
- Die Fortbildung richtet sich an alle Lateinlehrer.
- Suche Putzkraft für Büroreinigung.
Jetzt mal Hand aufs Herz: Welche Bilder entstehen in Ihrem Kopf? Bei welchem Satz denken Sie an einen Mann, bei welchem an eine Frau? Sehen Sie: Das ist der Grund, warum das Argument mit dem generischen Maskulinum nicht wirklich greift.
Übrigens auch bei hartnäckigen Kritikern der gendergerechten Sprache selbst nicht, wie eine an mich gerichtete E-Mail beweist, die mich dazu aufforderte, den Vereinsmeier-Aufruf zu unterstützen. Darin heißt es:
„Liebe Alle,
der Verein Deutsche Sprache hat heute einen Aufruf mit dem Titel „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ an die Öffentlichkeit gegeben, der die Namen von illustren Erstunterzeichnern trägt, darunter namhafte Schriftsteller, Journalisten und Hochschullehrer – jeweils weibliche wie männliche.“ [Fettung durch mich, U. E.]
Kein Witz: Der Zusatz zeigt, dass der Autor (oder heißt es: das Autor? Ich komme ganz durcheinander…) sich dann doch nicht so richtig auf die wundersamen Wirkungen des generischen Maskulinums verlassen wollte. Offensichtlich war diesem Menschen wahnsinnig wichtig zu verdeutlichen, dass auch Frauen zu den Mitunterzeichnenden gehören. Seltsam, oder?
Das Argument, dass die Grammatik ein generisches Maskulinum vorsieht und es damit dann eben auch seine unbezweifelbare Richtigkeit hat, ist im Übrigen seltsam nomistisch gedacht. Im Grunde verhält es sich damit wie mit den 10 Geboten. Da entwickelt eine Population – noch mehr tierischer als menschlicher Art – Verhaltensregeln, die das Zusammenleben nicht nur erleichtern, sondern erst ermöglichen. Um ihnen mehr Durchschlagskraft zu verleihen, schreiben Schriftkundige diese in einem späteren Stadium nieder und führen danach einen Etikettenschwindel der besonderen Art durch: Sie schieben die Autorenschaft keinem Geringeren als Gott im Himmel in die Schuhe. Eigentlich ein Fall für einen Fachanwalt für Urheberrecht. Und dennoch wirksam: Wenn Gott dieses Gesetz gemacht hat, tja, dann kann man das wohl nicht mehr ändern. Son Mist aber auch.
Nicht anders verhält es sich bei dem generischen Maskulinum: Da entwickelt eine männerdominierte Gesellschaft eine Sprache, in der vor allem – wie soll es anders sein? – Männer dominieren. Wie bei den 10 Geboten gehen auch hier irgendwann Schriftkundige daran, die historisch gewachsenen Sprachgewohnheiten niederzuschreiben und im Rahmen einer Grammatik zu systematisieren. Im Rahmen dieser Inventarisierung passiert etwas Entscheidendes: Die a posteriori beschriebenen Regeln verwandeln sich zu einer A-priori-Setzung, zu einem ehernen Gesetz, das jede weitere Veränderung unmöglich macht. Denn ab diesem Moment lässt der Gott der Grammatik keinen Zweifel mehr daran, dass seine Tontafeln vollgeschrieben sind und Korrekturwünsche eine ziemliche Anmaßung darstellen. Und so beten wir inbrünstig mit diesem Gott auch das generische Maskulinum an und verlieren darüber das Gefühl, dass es sich bei letzterem – wie gesehen – um ausgemachten Bullshit handelt.
No century for old men
Damit sind wir am Kern dieses Aufrufs angekommen. Das, was die Autorinnen (die Männer sind immer mitgemeint) als „Widerstand“ bezeichnen, muss man als Ausdruck für das natürliche Beharrungsvermögen alternder Menschen begreifen. Diese bedauernswerten Geschöpfe haben sich nun über Jahrzehnte in ihr Leben eingewöhnt und möchten sich nicht noch einmal gegen Ende ihres Daseins verändern wollen. Damit ist dieses 21. Jahrhundert offensichtlich nicht wirklich für diese Männer gemacht (selbstredend sind hier Frauen immer mitgemeint). Nachvollziehbar. Nur sollten sie ihre eigene inhärente Trägheit nicht mit dem Begriff „Widerstand“ veredeln wollen; (dies sei hier nur am Rande mal für die Rettung der deutschen Sprache ausgesprochen).
Dabei lässt sich gendergerechte Sprache wirklich leicht umsetzen und tut auch wirklich nicht weh. Hand drauf. Es bedarf nur weniger Kniffe, um diesen Anforderungen gerecht zu werden – und das, ohne dabei den Text zu verhunzen. Da arbeitet man mal mit dem Binnen-I, dann mit Formulierungen nach dem Muster „Bürgerinnen und Bürger“, dann wieder mit dem Wechsel von weiblicher und männlicher Form und nicht zuletzt durch den Einsatz von substantivierten Partizipien.
Das Ergebnis: Ein durch und durch lesbarer Text. Die Schriftstellerin Nina George wundert sich zu recht, als sie sich wie folgt ausließ: „Ich weiß also gar nicht, warum sich auch erfahrene Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die diesen seltsamen „Unfug“-Aufruf unterzeichnet haben, sich so schwer damit tun, ihr eigenes Handwerk zu beherrschen.“
Jetzt mal unter uns: Kann es für Schriftsteller, Journalisten, Hochschullehrer und andere Textwerker eigentlich eine größere Klatsche geben? Für männliche wie weibliche?